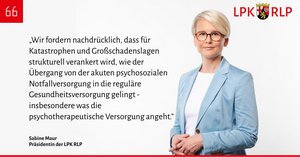Fachtagung „Opferschutz“: Strukturen verbessern, Kooperation stärken
Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und den Opferbeauftragten der Landesregierung Rheinland-Pfalz, Detelf Placzek, sowie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) verbindet seit Jahren eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Um die Erfahrungen der letzten Großschadenslagen bezüglich des Opferschutzes in Rheinland-Pfalz zu reflektieren und zielführende Vorgehensweisen für die Zukunft zu entwickeln, fand am 23. Oktober 2025 in Mainz eine große Fachtagung zum Thema „Opferschutz“ statt. Das Interesse der Kammermitglieder an der Veranstaltung war groß und die zur Verfügung stehenden Plätze waren schnell ausgebucht.
Vorträge und Praxiseinblicke renommierter Expert*innen beleuchteten unterschiedliche Aspekte des Opferschutzes. Kammerpräsidentin Sabine Maur hielt eine Begrüßungsrede und nahm an der abschließenden Podiumsdiskussion teil.
In ihrer Rede betonte Frau Maur die Bedeutung der Veranstaltung vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftspolitischer Debatten: Die nachvollziehbare Angst der Menschen vor Gewalt werde populistisch instrumentalisiert und es werde unfachlich, einseitig und rassistisch gegen vermeintliche klare „Tätergruppen“ gehetzt. Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen werden häufig unter Generalverdacht gestellt und es wird diskutiert, sie in „Registern“ zu erfassen. Statt unsachlicher Debatten sei interdisziplinäre und konstruktive Zusammenarbeit für wirksamen Opferschutz wichtig, so Frau Maur.
In ihrer Rede hob die Präsidentin drei zentrale Aspekte des Opferschutzes aus psychotherapeutischer Sicht hervor:
1. Positive Entwicklungen im Opferschutz in den letzten Jahren
Frau Maur lobte, dass das neue Soziale Entschädigungsrecht SGB XIV nun auch neben den körperlichen die psychischen Gewalttaten in den Blick nimmt. Die massiven psychischen und psychosozialen Folgen von interpersoneller Gewalt, von Terror und Amok, von großen Unglücken und Naturkatastrophen werden nun anerkannt. Hierzu zählen insbesondere Traumafolgestörungen, Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und psychosomatische Erkrankungen. Diese psychischen Folgen können sehr langfristig sein und erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche haben, wie beispielsweise Arbeitsfähigkeit, soziale und familiäre Beziehungen und auch auf die Gesellschaft als Ganzes.
Ein weiterer großer Fortschritt sei außerdem, dass nicht mehr nur die direkt von Gewalt betroffene Person gesehen und versorgt wird, sondern auch deren Angehörige und Zugehörige, Zeug*innen und Helfer*innen.
Sabine Maur betonte, dass die Landespsychotherapeutenkammer all diese Aspekte direkt und mit Nachdruck nach der Flutkatastrophe im Ahrtal an die Politik kommuniziert hat, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden konnten. Dies sei sehr ernst genommen und beherzigt worden. Die Umsetzung der angemahnten psychosozialen Maßnahmen für die Opfer seien im wesentlichen Detlef Placzek zu verdanken.
2. Strukturen des Opferschutzes müssen verbessert werden
Der Opferbeauftragte, die Kammern, die Kassenärztliche Vereinigung sowie Politik, Krankenkassen und Kliniken haben nach der Flutkatastrophe im Ahrtal große Anstrengungen unternommen, um den Betroffenen psychotherapeutische und psychiatrische Hilfen zukommen zu lassen. Solche Hilfen und der Zugang dazu dürfen aber zukünftig nicht mehr von der zufälligen Einsatzbereitschaft einzelner abhängen, sondern müssen strukturell im Katastrophenschutz verankert werden, forderte Sabine Maur.
Es müsse außerdem klar geregelt werden, wie der Übergang von der akuten psychosozialen Notfallversorgung in die reguläre Gesundheitsversorgung gelingt, insbesondere in Bezug auf die psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung.
Darüber hinaus sei es wichtig, die viele Angebote der Opferhilfe besser bekannt zu machen, zu vernetzten und verbindliche Strukturen zu schaffen. Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz engagiert sich deshalb im Austausch und in der Fortbildung der Kammermitglieder zum Opferschutz, beispielsweise durch gemeinsame Veranstaltungen mit dem Weißen Ring, mit der Polizei, mit Opferbeauftragten (UBSKM, RLP), mit Richter*innen und Staatsanwält*innen sowie Fachberatungsstellen.
3. Der beste Opferschutz ist die Prävention von Gewalttaten
Aus jahrzehntelanger Forschung sind wichtige Risikofaktoren für die Entstehung von Gewalt hinreichend bekannt, stellte Sabine Maur klar. Der Hauptrisikofaktor für Gewalt sei natürlich nicht die Nationalität oder die Ethnie eines Menschen, sondern männliches Geschlecht. Daher sei es die Pflicht von Männern, das Verhalten von Männern zu ändern, gewalttätiges Verhalten von Männern zu verhindern und zu sanktionieren und für Sicherheit zu sorgen.
Weitere Faktoren, die Gewalt begünstigen, seien unter anderem erlebte Gewalt in der Kindheit, Armut, schlechte Schulbildung, hohe Arbeitslosigkeit, kriminelle Milieus, fehlende Freizeitangebote sowie der Missbrauch von Alkohol und Drogen. Deutschland brauche endlich eine durchschlagende Präventionsstrategie. Hierzu gehören unter anderem die frühe Förderung und Unterstützung von Risikofamilien, die Intensivierung von schulbasierten Maßnahmen, der frühe und niedrigschwellige Zugang zu Beratung, Psychotherapie und Suchtbehandlung, sowie eine Stärkung von integrativen Nachbarschaftsangeboten und sozialer Gemeinschaft. Dementsprechend schloss die Kammerpräsidentin ihre Rede mit einem Zitat des Strafrechtlers Franz von Liszt: „Die beste Gewaltprävention ist eine gute Sozialpolitik“.
Weitere Informationen zur erfolgreichen Veranstaltung „Opferschutz“ können Sie dem Tagungsprogramm entnehmen. Das Programm finden Sie hier.